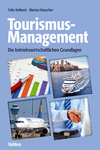Zusammenfassung
Vorteile
- Umfassendes Grundlagenwerk zur touristischen Betriebswirtschaftslehre
- Im deutschsprachigen Bereich ohne Beispiel
- Abdeckung aller wesentlichen Funktionsbereiche des Tourismus-Managements
- Eignung für Studierende und Praktiker
- Zahlreiche Praxis-Kurzbeiträge von Führungskräften
Zum Werk
Die Tourismusbranche gehört zu den am stärksten wachsenden, aber auch komplexesten Wirtschaftsbereichen.
Dieses Werk vermittelt erstmalig ein umfassendes betriebswirtschaftliches Grundwissen für die Tourismusbranche für Studium und Praxis, das alle wesentlichen Bereiche der Betriebswirtschaftslehre abdeckt. Es unterstützt Studierende und Praktiker bei der Entwicklung einer betriebswirtschaftlichen Denkhaltung, die sinnvolles aktives Handeln („Management“) im touristischen Geschäft ermöglicht.
Das Buch beschreibt auf der Basis eines integrierten Management-Modells Investition und Finanzierung, Beschaffung, Produktion und Marketing sowie die Managementprozesse Planung, Steuerung, Personalmanagement und Organisation. Den Abschluss bilden langfristige Überlegungen zur strategischen Unternehmensführung sowie zum nachhaltigen Tourismusmanagement.
Zahlreiche Experten-Statements von Führungskräften aus der Branche illustrieren die Praxisrelevanz.
Autoren
Prof. Dr. Felix Kolbeck und Prof. Dr. Marion Rauscher, Fakultät für Tourismus, Hochschule München
Zielgruppe
- Studierende der Bachelor-Studiengänge Tourismusmanagement, Masterstudiengänge, Weiterbildungsangebote (IHK, MBA, …) und Tourismusunternehmen.
- 65–79 1.5.2 Unternehmen 65–79
- 103–110 2.1.4 Finanzierung 103–110
- 116–142 2.2 Beschaffung 116–142
- 142–169 2.3 Produktion 142–169
- 169–195 2.4 Marketing 169–195
- 182–193 2.4.4 Der Marketing-Mix 182–193
- 195–220 3.1 Planung 195–220
- 210–215 3.1.4 Operative Planung 210–215
- 249–274 3.3 Personalmanagement 249–274
- 265–271 3.3.4 Personalführung 265–271
- 274–295 3.4 Organisation 274–295
- 339–349 Stichwortverzeichnis 339–349
- 349–349 Impressum 349–349