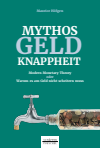Mythos Geldknappheit
Modern Monetary Theory oder warum es am Geld nicht scheitern muss
Zusammenfassung
Klimakrise, Pandemie, Ungleichheit, politischer Rechtsruck ― große gesellschaftliche Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Leider scheitern Reformen zumeist an der Frage: "wie sollen wir das bezahlen?". Weit verbreitete Irrtümer zur Funktionsweise des Geldsystems und ökonomischen Zusammenhängen führen dazu, dass wir den politischen Handlungsspielraum des Staates chronisch unterschätzen ― auf Kosten des Gemeinwohls.
Dieses Buch entlarvt den Mythos der Geldknappheit und skizziert progressive Reformen für eine Zukunft in Prosperität und Nachhaltigkeit ― im Sinne des Gemeinwohls. All das, wozu wir technisch in der Lage sind, und worauf wir uns demokratisch einigen können, können wir uns auch leisten. Ein anderer Wirtschaftsentwurf ist möglich!
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–10
- 11–16 Danksagung 11–16
- 17–24 Einleitung: Die Wirtschaft als Mittel zum Zweck 17–24
- 25–26 Einen Schritt zurück – Unser Geldsystem verstehen 25–26
- 27–68 1 Was ist Geld und woher kommt es? 27–68
- 1.1 Das Wesen des Geldes: Ausdruck einer Schuldbeziehung
- 1.2 Die Akzeptanz des Geldes
- 1.3 Auf der Spur des Geldes: Das Geldsystem und dessen Akteure
- 1.4 Wie tätigt ein Staat seine Ausgaben?
- 1.5 Der indirekte Weg: Umweg über Banken
- 1.6 Der direkte Weg: Standleitung zur Zentralbank
- 1.7 Die konsolidierte Staatsbilanz
- 1.8 Bankkredite: Die Quelle des Giralgeldes
- 1.9 Warum werben Banken um meine Ersparnisse?
- 1.10 Staatliche und private Geldschöpfung: Eine Differenzierung
- 69–84 2 Der Staat ist kein Haushalt: Die Bedeutung des Währungsmonopols 69–84
- 2.1 Staatliche Währung als Steuergutschrift
- 2.2 Die Haushaltsanalogie entlarvt
- 2.3 Steuern finanzieren nicht die Ausgaben des Währungsherausgebers
- 2.4 Defizite und Schulden: Eine Einordnung aus neuem Blickwinkel
- 85–102 3 Das Spektrum monetärer Souveränität und das fatale Design der Eurozone 85–102
- 3.1 Das Spektrum monetärer Souveränität
- 3.2 Die Eurozone: Zum Scheitern designt
- 3.3 Die Zukunft der Eurozone
- 103–118 4 Inflation: Kein Grund zur Hysterie 103–118
- 4.1 Was genau ist »Inflation«?
- 4.2 Das Preisniveau und der Einfluss des Staates
- 4.3 Inflation ist primär ein Verteilungskonflikt
- 4.4 Woher kommt die Inflation?
- 4.5 Zur Vermeidung und Bekämpfung von Inflation
- 119–128 5 Steuern als wichtiges Tool – aber nicht zur Finanzierung 119–128
- 5.1 Die vier wirtschaftspolitischen Funktionen von Steuern
- 5.2 Jede Steuer bedeutet Opportunitätskosten
- 129–136 6 Staatsanleihen als unnötiges Tool – auch zur Finanzierung 129–136
- 6.1 Staatsanleihen als Tool zur Zinssteuerung
- 6.2 Altes Denken, erschwerte Geldpolitik und reale Kosten
- 137–146 7 Progressive Reformen – Neues Framing, neues Glück 137–146
- 7.1 Eingeschränkter Debattenraum
- 7.2 Von neoliberalen Metaphern und deren gesellschaftlichen Folgen
- 7.3 Neues Framing, neues Glück
- 147–152 8 Zusammengefasst: Es geht um Ressourcen, nicht um Finanzierung! 147–152
- 153–154 Zwei Schritte nach vorne – Progressive Reformvorschläge 153–154
- 155–158 9 Wohin soll die Reise gehen? 155–158
- 159–182 10 Jobgarantie: Das Ende unfreiwilliger Arbeitslosigkeit 159–182
- 10.1 Das Design der Jobgarantie
- 10.2 Zur Verwaltung der Jobgarantie
- 10.3 Die Jobgarantie als Mittel für sozialgesellschaftlichen Fortschritt
- 10.4 Ist die Jobgarantie finanzierbar?
- 10.5 Die Jobgarantie als makroökonomisches Steuerungstool
- 10.6 Garantierter Job vs. garantiertes Einkommen – JG vs. BGE
- 183–200 11 Öffentliche Daseinsvorsorge erster Klasse: Von Bildung bis Wohnen 183–200
- 11.1 Grundsätzlicher Paradigmenwechsel
- 11.2 Moderne Infrastruktur und dichtes Transportnetz
- 11.3 Vielfältiges Angebot an Sport- und Kultureinrichtungen
- 11.4 Verlässliche und lebensstandardsichernde Rente
- 11.5 Erstklassige Gesundheits- und Pflegeversorgung
- 11.6 Neue Maßstäbe in Bildung, Ausbildung und Forschung
- 11.7 Soziale Stadtentwicklung und Wohnen als Grundrecht
- 201–214 12 Steuerreform: Qualität vor Quantität 201–214
- 12.1 Anforderungen an ein gemeinwohlorientiertes Steuersystem
- 12.2 Die Unternehmenssteuer: Von Progressiven zu Unrecht verehrt
- 12.3 Die Mehrwertsteuer: Regressiver wird’s nicht mehr
- 12.4 Ein Gegenvorschlag: Gemeinwohl vor Einkommensgenerierung
- 215–228 13 Bankenreform: Gemeinwohl vor Profit 215–228
- 13.1 Status quo: Großbanken als Herde von Instabilität und Ungleichheit
- 13.2 Banking muss wieder langweilig werden
- 13.3 Die Gretchenfrage: Privat oder Staat?
- 13.4 Auch andere Finanzmarktakteure gehören eingefangen
- 229–238 14 Geldpolitik: Schluss mit Nebelkerzen 229–238
- 14.1 Zentralbanker: Kinderlenkrad statt Autosteuer
- 14.2 Geld- gegen Fiskalpolitik: David ohne Steinschleuder gegen Goliath
- 14.3 Permanente Nullzinspolitik
- 14.4 Die Nebelkerze Staatsanleihen gehört ausgeblasen
- 239–254 15 Ökologische Transformation: Der Green New Deal 239–254
- 15.1 Der Staat oder keiner
- 15.2 Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammen denken
- 15.3 Neue Spielregeln für die Marktwirtschaft
- 15.4 Die relevanten Kosten des Green New Deals
- 15.5 Denken in Transformation statt in Wachstum
- 255–260 16 Zusammengefasst: Den Staat und dessen Möglichkeiten neu denken 255–260
- 261–262 Schlusswort: Auf zum Paradigmenwechsel! 261–262
- 263–264 Bonusmaterial 263–264
- 265–266 Literaturempfehlungen 265–266
- 267–272 Bibliographie 267–272
- 273–282 Stichwortverzeichnis 273–282
- 283–283 Der Autor 283–283