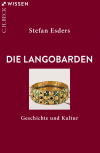Die Langobarden
Geschichte und Kultur
Zusammenfassung
Dieser Band vermittelt knapp und prägnant unseren Wissensstand über Mythos, Herkunft und Identität, Religion, Recht und Gesellschaft sowie Schrift und Sprache der Langobarden. Im Zentrum aber steht die historische Entwicklung des Langobardenreiches insgesamt sowie seiner verschiedenen Regionen und wichtigsten Orte. 568/69 von König Alboin gegründet, prägt es gut 200 Jahre die Kultur weiter Teile Italiens. Seine eigenständige Geschichte endet im Jahr 774, als sich der Frankenherrscher Karl zum König der Langobarden krönen lässt. Ein Ausblick auf ihr kulturelles Erbe und die Nachwirkungen der Langobardenzeit beschließt die Darstellung.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–7 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–7
- 8–10 Die Aktualität der Langobarden 8–10
- 10–25 1. Herkunft und Identität der Langobarden bis zu ihrer Invasion Italiens (568) 10–25
- Der Mythos der «Langbärte»
- Vom Norden an die Donau: Kontinuität und Wanderung eines Volkes?
- Die Langobarden in Pannonien und im Gotenkrieg Kaiser Justinians
- König Alboin und der langobardische Zug nach Italien (568/569)
- Elemente und Entwicklungsstufen langobardischer Identität
- Die Langobarden in Pannonien und Italien als Gegenstand der «Genetic history»
- 25–53 2. In Italien ankommen: Die Konsolidierung der langobardischen Herrschaft (584 – 636) 25–53
- Die Herzöge: Eine stadtbasierte Militäradministration
- Das Exarchat von Ravenna und die langobardische Monarchie
- Agilulf (590 – 616), Theodelinde und zwei Königserhebungen in Mailand
- Königin Theodelinde, Papst Gregor I. und der Domschatz von Monza
- Der politischen folgt die kirchliche Fragmentierung: Rom, Mailand und Ravenna um 600
- Der Dreikapitelstreit und die Spaltung des Patriarchats von Aquileia
- Columban, Agilulf und die Gründung des Klosters Bobbio (613)
- Die langobardische Gesellschaft im 7. Jahrhundert
- König Rothari (636 – 652), sein Edikt und das Recht des Königs
- Eine militante Gesellschaft, ihr monetäres «Strafrecht» und der gewöhnliche Totschlag
- Die «bevormundeten» Mitglieder innerhalb der langobardischen Rechtsgemeinschaft
- Ethnische Rechtsidentität als Mittel zur kontrollierten Vermehrung der Langobarden
- Die langobardische Sprache und Namengebung
- Königliche Gerichtsbarkeit und Privilegierungspraxis
- 53–67 4. Über den Apennin und zurück: Die Langobarden in Mittel- und Süditalien 53–67
- Das Herzogtum Lucca und die «Geburt» der Toskana
- Aus dem Schatten Umbriens gegen Rom und Ravenna: Das Herzogtum Spoleto
- Aus Kampanien gegen griechische Küstenstädte und Rom: Das Herzogtum Benevent
- Die dynastische Vereinigung der langobardischen Gebiete unter König Grimoald (662 – 671)
- Die Militärintervention des oströmischen Kaisers Konstans II. in Süditalien (663 – 668)
- Vom Monte Gargano nach Pavia: Der Erzengel Michael auf dem Flug nach Norden
- 67–81 5. Religiöse Einheit, äußere Anerkennung und innerer Widerstand, 671 – 700 67–81
- Perctarit (671 – 688), Rodelinde und der Ausbau Pavias als Herrschaftszentrum
- Der oströmisch-langobardische Friedens- und Anerkennungsvertrag (ca. 678)
- Damian von Pavia, die Kirchenprovinz Mailand und das VI. Ökumenische Konzil (680/81)
- Die Rebellionen des Herzogs Alahis und die Schlacht bei Coronate (689)
- Die Synode von Pavia (698) und das Ende des Dreikapitelschismas
- 81–96 6. «Fürst des katholischen und gottgeliebten Volkes der Langobarden»: Das Zeitalter König Liutprands (712 – 744) 81–96
- Ein Reliquientransfer, der Bilderstreit und die Auflösung vertrauter Allianzen (ca. 725 – 732)
- Neue Regeln für eine christliche Gesellschaft: Liutprands Gesetzgebung
- Königliche Wirtschaftspolitik: Po-Handel, Münzwesen, Krongüter und Bauhandwerk
- Langobarden, Bayern und Franken: Der Wandel der nordalpinen Konstellation
- Rom, die südlichen Herzogtümer und eine fränkische Absage
- 96–106 7. Ein triumphaler Erfolg als Wendepunkt in der langobardischen Geschichte 96–106
- Ratchis und Aistulf, zwei königliche Brüder aus Friaul (744 – 757)
- Das Ende des Exarchats von Ravenna (751)
- Die Entstehung des Kirchenstaates (754 – 757)
- 106–121 8. König Desiderius, die fränkische Invasion und das Ende des Langobardenreiches (757 – 788) 106–121
- Regieren, Stiften und Verbünden in Krisenzeiten: Desiderius (757 – 774) und Ansa
- 774: Der historische Kontext der fränkischen Eroberung Oberitaliens
- Die neue Ordnung der Dinge: Ein Franke als «König der Langobarden»
- Mehr als ein Nachspiel: Herzog Arichis II. (758 – 787) und der Fürstenhof in Benevent
- 121–129 9. Die Langobarden in Italien: Bilanz, Nachwirkung und kulturelles Erbe 121–129
- Regierungszeiten der langobardischen Könige
- Hinweise zu Quellen und Literatur
- 129–130 Karte 1 (Umschlaginnenseite vorne): Oberitalien um 700 129–130
- 130–130 Karte 2 (Umschlaginnenseite hinten): Mittel- und Unteritalien um 700 130–130