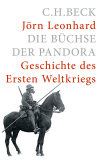Die Büchse der Pandora
Geschichte des Ersten Weltkriegs
Zusammenfassung
Der Erste Weltkrieg sprengte alles, was sich die Welt vor 1914 hatte vorstellen können. Er wirkte wie die Büchse der Pandora – jenes mythische Schreckensgefäß, aus dem alle Übel der Welt entwichen, als man gegen den Rat der Götter seinen Deckel hob. Jörn Leonhard erzählt die Geschichte des Krieges so vielschichtig wie nie zuvor. Er führt den Leser auf vergessene Schlachtfelder und versetzt ihn abwechselnd in die Hauptstädte aller beteiligten Staaten.
So entfaltet dieses Buch ein beeindruckendes Panorama. Es zeigt, wie die Welt in den Krieg hineinging und wie sie aus ihm als eine völlig andere wieder herauskam. Es nimmt nicht nur die Staaten und Nationen in den Blick, sondern auch die Imperien in Europa und weit darüber hinaus. Es beschreibt die dynamische Veränderung der Handlungsspielräume, die rasanten militärischen Entwicklungen und die immer rascheren Wandlungen der Kriegsgesellschaften. Und es lässt die Erfahrungen ganz unterschiedlicher Zeitgenossen wieder lebendig werden: von Militärs, Politikern und Schriftstellern, Männern und Frauen, Soldaten und Arbeitern. Jörn Leonhard ist eine zeitgemäße und moderne Geschichte des Ersten Weltkriegs gelungen, die es so bisher noch nicht gegeben hat: europäisch vergleichend, global in der Perspektive, souverän in der Darstellung.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–29 I. Erbschaften: Der Erste Weltkrieg und das lange 19. Jahrhundert Europas 9–29
- 29–83 II. Vorläufe: Kriegseinhegung und Krisenverdichtung vor 1914 29–83
- 29–48 1. Machtbalancen und Veränderungsdynamik 29–48
- 48–67 2. Konflikträume und Handlungslogiken 48–67
- 67–74 3. Fortschrittspanoramen und Kriegsszenarien 67–74
- 74–83 4. Meistererzählungen und offene Ausgänge 74–83
- 83–265 III. Entgleisung und Eskalation: Sommer und Herbst 1914 83–265
- 83–127 1. Die Inkubation des Krieges: Krisenspiralen, Parallelaktionen und gescheitertes Risikomanagement 83–127
- 127–146 2. August-Panoramen: Euphorie, Angst und die Logiken des Rückblicks 127–146
- 146–154 3. Maschinen und Material: Eskaliertes Töten im Krieg 146–154
- 154–160 4. Soldat werden, Soldat sein: Von der Rekrutierung zum Massenheer 154–160
- 160–205 5. Dynamische Gewalt: Globale Zonen und lokale Erfahrungen 160–205
- 205–221 6. Kontrolle und Knappheit: Militarisierte Staatlichkeit und improvisierte Kriegsökonomien 205–221
- 221–236 7. Die Regime von Loyalität und Anerkennung: Nationen und Großreiche von innen 221–236
- 236–250 8. Kriegsdeutungen: Nationale Selbstversicherung und intellektuelle Ermächtigung 236–250
- 250–265 9. Fünf Monate Krieg: Mobilisierung, Desillusionierung und die Ironie des Krieges 250–265
- 265–430 IV. Stillstand und Bewegung: 1915 265–430
- 265–282 1. Die Suche nach militärischen Entscheidungen: Kampfzonen und Strategien 265–282
- 282–294 2. Gewalt im Schatten des Krieges: Besatzungsregime und die Erfahrung ethnischer Differenz 282–294
- 294–307 3. Progressive Kriegsmittel, Gewaltexpansion und politische Kosten: Die technologische Mobilisierung im Gaskrieg und U-Boot-Einsatz 294–307
- 307–325 4. Abwartende Neutralität und konkurrierende Versprechen: Neue Kriegsakteure und ihre Expansionsfantasien 307–325
- 325–347 5. Kontingenz und Eigensinn: Die Front als soldatischer Erfahrungsraum und die Grenzen der nationalen Kriegsrhetorik 325–347
- 347–386 6. Drückeberger, Profiteure, Verräter: Die Heimatfronten zwischen ökonomischen Zwängen, Sozialkonflikten und politischer Labilität 347–386
- 386–415 7. Multiethnische Kriegsgesellschaften: Von der umkämpften Loyalität zur Eskalation ethnischer Gewalt 386–415
- 415–424 8. Krieg begründen, Gewalt verstehen: Intellektuelle Muster der Erfahrungsaneignung 415–424
- 424–430 9. 17 Monate Krieg: Radikalisierung und Ausweitung des Krieges unter der Oberfläche von Stillstand und Bewegung 424–430
- 430–614 V. Abnutzen und Durchhalten: 1916 430–614
- 430–470 1. Totale Schlachten, strategische Sackgassen, neue Taktiken: Der Umbruch zum modernen Krieg an der Westfront und auf See 430–470
- 470–490 2. Raum und Bewegung: Der Preis des expandierenden Krieges in Südosteuropa und im Nahen Osten 470–490
- 490–525 3. Hunger und Mangel, Zwang und Protest: Die Tektonik der Durchhalte-Gesellschaften 490–525
- 525–548 4. Politikwandel: Von den Grenzen der imperialen Ordnung zur Krise der politischen Legitimation 525–548
- 548–563 5. Menschenmaterial und Materialschlacht: Planungslogiken, Fronterfahrungen, Bewältigungsstrategien 548–563
- 563–579 6. Körper und Nerven: Die neue Kontur des Kriegsopfers 563–579
- 579–595 7. Die Sprachen des Krieges: Kommunikation, Kontrolle und die Grenzen der Meinungslenkung 579–595
- 595–608 8. Die Krise der Repräsentation: Bilder und Inszenierungen des Krieges 595–608
- 608–614 9. 29 Monate Krieg: Erwartungen und Erfahrungen in der Mitte des Krieges 608–614
- 614–806 VI. Expansion und Erosion: 1917 614–806
- 614–634 1. Krisenerfahrungen und Innovationen: Die Ungleichzeitigkeit der Räume und der neue Krieg des 20. Jahrhunderts 614–634
- 634–651 2. Die Grenzen der Belastung: Die Soldaten des Jahres 1917 zwischen Devianz und Protest, Gefangenschaft und Politik 634–651
- 651–661 3. Lenin und Wilson: Doppelter Internationalismus als revolutionärer Bürgerkrieg und demokratische Intervention 651–661
- 661–688 4. Revolutionen, Staatszerfall und Gewaltkontinuum: Russland zwischen Staatenkrieg und Bürgerkrieg 661–688
- 688–706 5. Prekäre Versprechen: Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten und die Frage nach der amerikanischen Nation 688–706
- 706–722 6. Die Revolution steigender Erwartungen: 1917 als globaler Moment 706–722
- 722–758 7. Soziale Polarisierung und politische Erosion: Die Grenzen des Konsenses in den Heimatgesellschaften 722–758
- 758–767 8. Die doppelte Defensive: Liberale im Krieg 758–767
- 767–784 9. Demografie, Klasse und Geschlecht: Die Konturen der Kriegsgesellschaften 767–784
- 784–796 10. Die wirtschaftliche und monetäre Tektonik des Krieges: Die politische Ökonomie einer neuen Weltordnung 784–796
- 796–806 11. 41 Monate Krieg: Das «unmögliche Jahr» zwischen Utopienkonkurrenz und Friedensillusion 796–806
- 806–939 VII. Plötzlichkeit und Zerfall: 1918 806–939
- 806–827 1. Von der Front zum Gewaltraum: Diktatfrieden und Bürgerkrieg im Osten Europas 806–827
- 827–856 2. Endspiel: Die andere Wiederkehr des Krieges von 1914 an der Westfront 827–856
- 856–862 3. Auflösungskämpfe: Der vorweggenommene Nachkrieg im Süden und Südosten Europas 856–862
- 862–872 4. Remobilisierung und teure Siege: Der Preis des Zusammenhalts in den alliierten Kriegsgesellschaften 862–872
- 872–895 5. Erwartungsstau und Krisenverdichtung: Deutschland zwischen Siegfriedensutopien und dem Ende der Monarchie 872–895
- 895–915 6. Zerfallskriege und Unabhängigkeitskämpfe: Die Auflösung der kontinentaleuropäischen Empires 895–915
- 915–926 7. Waffenstillstand oder Kapitulation: Das Kriegsende im Zeichen der Erschöpfung 915–926
- 926–939 8. 52 Monate Krieg und ein Monat Frieden: Offenheit von Sieg und Niederlage, Ungleichzeitigkeit von Krieg und Frieden 926–939
- 939–979 VIII. Ausgänge: Kriege im Frieden und die Konkurrenz neuer Ordnungsmodelle 1919–1923 939–979
- 979–997 IX. Gedächtnisse: Fragmentierte Erfahrungen und polarisierte Erwartungen 979–997
- 997–1015 X. Hypotheken: Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert der globalen Konflikte 997–1015
- 1015–1019 Schaubilder 1015–1019
- 1019–1070 Anmerkungen 1019–1070
- 1070–1134 Quellen- und Literaturverzeichnis 1070–1134
- 1134–1135 Verzeichnis der Karten, Tabellen und Schaubilder 1134–1135
- 1135–1136 Bildnachweis 1135–1136
- 1136–1137 Dank 1136–1137
- 1137–1144 Personenregister 1137–1144
- 1144–1168 Sach- und Ortsregister 1144–1168