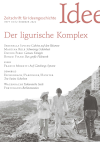Aargauer Kantonsbibliothek
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Andrassy Universität Budapest
Badische Landesbibliothek
Bauhaus-Universität Weimar
Berliner Hochschule für Technik
Berufsakademie Sachsen
Bibliothek der Technischen Hochschule Aschaffenburg
Brandenburgische Technische Universität
Catholic University of America
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
DHBW Baden-Württemberg-CAS
Deutsche Sporthochschule Köln
Duale Hochschule Baden Württemberg Heidenheim
Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach
Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe c/o KIT-Bibliothek
Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen
Europa-Universität Flensburg
Evangelische Hochschule Dresden
Evangelische Hochschule Nürnberg
FH CAMPUS 02
FH Oberösterreich
FH Vorarlberg
Fachhochschule Erfurt
Fachhochschule Münster
Fachhochschule Südwestfalen
Fachhochschule Westküste
Frankfurt School of Finance & Management
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Goethe Universität Frankfurt
HAW Hamburg
HTWG Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
HdM Stuttgart
Helmut-Schmidt-Universität
Hochschul- und Landesbibliothek Hochschule RheinMain
Hochschulbibliothek der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Hochschule Aalen
Hochschule Augsburg
Hochschule Biberach
Hochschule Darmstadt
Hochschule Düsseldorf
Hochschule Esslingen
Hochschule Furtwangen | Furtwangen University
Hochschule Harz
Hochschule Heilbronn
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft c/o KIT-Bibliothek
Hochschule Kehl
Hochschule Kempten
Hochschule Koblenz - RheinAhrCampus
Hochschule Magdeburg-Stendal
Hochschule Mannheim
Hochschule Mittweida
Hochschule Neubrandenburg
Hochschule Niederrhein
Hochschule Offenburg
Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW)
Hochschule Reutlingen
Hochschule Ruhrwest
Hochschule Wismar
Hochschule Worms
Hochschule Zittau/Görlitz
Hochschule für Fernsehen und Film
Hochschule für Technik Stuttgart
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Humboldt-Universität zu Berlin
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Johannes Kepler Universität Linz
Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
Kunstakademie Düsseldorf
Kunsthochschule für Medien Köln
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Pädagogische Hochschule Freiburg
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Pädagogische Hochschule Zürich
RWTH Aachen
Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH
Ruhr Universität Bochum
SLUB Dresden (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek)
Staats- u. Universitätsbibliothek Bremen
Swansea University
TU Braunschweig
Technische Hochschule Bingen
Technische Hochschule Brandenburg
Technische Hochschule Georg Agricola
Technische Hochschule Köln
Technische Hochschule Mittelhessen
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Technische Hochschule Rosenheim
Technische Hochschule Wildau
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Technische Universität Clausthal
Technische Universität Dortmund
Technische Universität Hamburg-Harburg
Technische Universität München - University Library
Testinstitution
Thüringer Universitäts und Landesbibliothek
UdK Berlin - Universität der Künste - Universitätsbibliothek
University of Basel
University of Manchester
University of Nottingham
Università degli Studi di Padova
Universität Augsburg
Universität Bern
Universität Bielefeld
Universität Göttingen
Universität Hohenheim
Universität Kassel
Universität Konstanz
Universität Leipzig
Universität Mannheim
Universität Marburg
Universität Osnabrück
Universität Paderborn
Universität Passau
Universität Regensburg
Universität Rostock
Universität Siegen
Universität Stuttgart
Universität Trier
Universität Vechta
Universität Würzburg
Universität der Bundeswehr München
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Universitätsbibliothek Bamberg
Universitätsbibliothek Bayreuth
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt
Universitätsbibliothek Greifswald
Universitätsbibliothek Heidelberg
Universitätsbibliothek Koblenz
Universitätsbibliothek LMU München
Universitätsbibliothek Tübingen
Vinzenz Pallotti University gGmbH
Westfälische Hochschule
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg