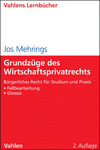- doi.org/10.15358/9783800648856
- ISBN print: 978-3-8006-3794-2
- ISBN online: 978-3-8006-4885-6
- C.H.BECK, München C.H.BECK, München
Zusammenfassung
"So macht Jura Freude" JuraInfo 07/12
Perfekt zur Prüfungsvorbereitung
Ausgerichtet auf die juristische Ausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern und verwandter Disziplinen in den ersten Semestern schafft das Lehrbuch einen leicht verständlichen Zugang zum Wirtschaftsprivatrecht. Behandelt werden BGB (Allgemeiner Tei), Allgemeines und Besonderes Schuldrecht sowie Sachenrecht einschließlich Recht der Kreditsicherung.
'Three in One':
* Zahlreiche Beispiele und Problemstellungen aus der Praxis
* Technik der Fallbearbeitung mit Musterlösungen
* Umfangreiches Glossar
"Es gibt viele Lehrbücher zum Wirtschaftsprivatrecht für Studierende an Fachhochschulen und Juristen der Anfangssemester dieses ist ein ganz besonderes; Unter Verzicht auf dogmatische oder theoretische Erörterungen wird der Leser schrittweise an die wichtigsten Rechtsfragen herangeführt, die sich im Wirtschaftsprivatrecht stellen.(...) So macht Jura Freude; so sollten juristische Lernbücher heute geschrieben sein. Der erste Einstieg in das Zivilrecht dürfte mit diesem Buch jedem gelingen. Fachhochschülern, aber auch Anfangssemestern im Jurastudium kann das Buch nur wärmstens empfohlen werden."
in: JuraInfo 07/12
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–19 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–19
- 20–33 Einleitung 20–33
- 33–172 1. Teil: Vertragsschluss und weitere Grundlagen 33–172
- 33–67 Kapitel 1: Der Abschluss von Verträgen 33–67
- 33–47 1.1 Angebot 33–47
- 47–53 1.2 Annahme 47–53
- 53–59 1.3 Schweigen als Annahme 53–59
- 59–63 1.4 Zugang von Willenserklärungen 59–63
- 63–67 1.5 Vorvertrag, Option, Letter of Intent 63–67
- 67–87 Kapitel 2: Die Privatautonomie 67–87
- 67–80 2.1 Die Vertragsfreiheit 67–80
- 80–86 2.2 Die Testierfreiheit 80–86
- 86–87 2.3 Die Vereinsfreiheit 86–87
- 87–115 Kapitel 3: Verbraucherschutz, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen 87–115
- 87–90 3.1 Verbraucher, Unternehmer, Kaufmann 87–90
- 90–92 3.2 Verbraucherschützende Regelungen 90–92
- 92–115 3.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen 92–115
- 115–126 Kapitel 4: Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Deliktsfähigkeit 115–126
- 115–120 4.1 Rechtsfähigkeit 115–120
- 120–123 4.2 Geschäftsfähigkeit 120–123
- 123–126 4.3 Deliktsfähigkeit 123–126
- 126–137 Kapitel 5: Gestaltungsrechte, insbesondere Anfechtung 126–137
- 126–127 5.1 Begriffe 126–127
- 127–130 5.2 Gestaltungsrechte 127–130
- 130–137 5.3 Anfechtung 130–137
- 137–157 Kapitel 6: Das Recht der Stellvertretung 137–157
- 137–139 6.1 Grundlagen des Vertretungsrechts 137–139
- 139–149 6.2 Voraussetzungen der Stellvertretung 139–149
- 149–153 6.3 Vertreter ohne Vertretungsmacht 149–153
- 153–154 6.4 Exkurs: Vertretung bei Personengesellschaften 153–154
- 154–156 6.5 Exkurs: Vertretung bei Kapitalgesellschaften 154–156
- 156–157 6.6 Selbstkontrahieren 156–157
- 157–163 Kapitel 7: Formvorschriften 157–163
- 157–158 7.1 Grundlagen der Formbedürftigkeit 157–158
- 158–158 7.2 Funktionen von Formvorschriften 158–158
- 158–160 7.3 Formarten des BGB 158–160
- 160–163 7.4 Rechtsfolgen von Formmängeln 160–163
- 163–172 Kapitel 8: Verjährung 163–172
- 163–164 8.1 Grundlagen 163–164
- 164–169 8.2 Verjährungsfristen 164–169
- 169–172 8.3 Neubeginn und Hemmung der Verjährung 169–172
- 172–340 2. Teil: Vertragliche Schuldverhältnisse 172–340
- 172–201 Kapitel 9: Vertragliche Schuldverhältnisse 172–201
- 172–177 9.1 Der Aufbau des BGB 172–177
- 177–178 9.2 Zustandekommen eines vertraglichen Schuldverhältnisses 177–178
- 178–180 9.3 Inhalte des Schuldverhältnisses 178–180
- 180–181 9.4 Vorvertragliche Schuldverhältnisse 180–181
- 181–193 9.5 Art und Zeit der Leistungserbringung 181–193
- 193–194 9.6 Leistung in Person oder durch einen Dritten 193–194
- 194–197 9.7 Abtretung von Forderungen 194–197
- 197–201 9.8 Gesamtschuld 197–201
- 201–207 Kapitel 10: Erlöschen von Schuldverhältnissen 201–207
- 201–202 10.1 Erlöschen durch Leistung 201–202
- 202–203 10.2 Annahme an Erfüllungs statt 202–203
- 203–205 10.3 Aufrechnung 203–205
- 205–207 10.4 Hinterlegung 205–207
- 207–215 Kapitel 11: Vergleich 207–215
- 207–207 11.1 Grundlagen 207–207
- 207–208 11.2 Außergerichtlicher Vergleich 207–208
- 208–215 11.3 Gerichtlicher Vergleich 208–215
- 215–230 Kapitel 12: Leistungsstörungen (Einführung) 215–230
- 215–217 12.1 Grundlagen 215–217
- 217–225 12.2 Die Grundvorschrift des § 280 Abs. 1 BGB 217–225
- 225–230 12.3 Anspruch aus § 280 Abs. 1 BGB (allein) 225–230
- 230–255 Kapitel 13: Verzögerung der Leistung (Verzug) 230–255
- 230–238 13.1 Grundlagen 230–238
- 238–239 13.2 Rechtsfolgen des Verzugs (Überblick) 238–239
- 239–243 13.3 Schadensersatz neben der Leistung 239–243
- 243–247 13.4 Schadensersatz statt der Leistung 243–247
- 247–248 13.5 Rücktritt vom Vertrag 247–248
- 248–249 13.6 Zusammenfassung zum Verzug 248–249
- 249–255 13.7 Vertragsstrafe und pauschalierter Schadensersatz 249–255
- 255–315 Kapitel 14: Schlechtleistung im Kaufrecht 255–315
- 255–257 14.1 Grundlagen 255–257
- 257–293 14.2 Voraussetzungen der Nacherfüllung 257–293
- 293–300 14.3 Rücktritt vom Vertrag 293–300
- 300–300 14.4 Minderung des Kaufpreises 300–300
- 300–302 14.5 Rückgriff des Unternehmers 300–302
- 302–311 14.6 Schadensersatz 302–311
- 311–315 14.7 Die Herstellergarantie 311–315
- 315–326 Kapitel 15: Exkurs: Die Produkthaftung (Produzentenhaftung) 315–326
- 315–318 15.1 Grundlagen 315–318
- 318–320 15.2 Produkthaftung nach §823 Abs. 1 BGB 318–320
- 320–326 15.3 Produkthaftung nach dem ProdHaftG 320–326
- 326–340 Kapitel 16: Weitere Leistungsstörungen 326–340
- 326–338 16.1 Unmöglichkeit 326–338
- 338–340 16.2 Störung der Geschäftsgrundlage 338–340
- 340–402 3. Teil: Einzelne vertragliche Schuldverhältnisse 340–402
- 340–361 Kapitel 17: Der Werkvertrag 340–361
- 340–342 17.1 Grundlagen 340–342
- 342–346 17.2 Abgrenzung zu anderen Verträgen 342–346
- 346–352 17.3 Einzelheiten zum Werkvertrag 346–352
- 352–355 17.4 Ansprüche des Bestellers bei Mängeln 352–355
- 355–357 17.5 Verjährungsfristen der Mängelansprüche im Werkvertragsrecht 355–357
- 357–359 17.6 Sicherung der Werklohnforderung 357–359
- 359–360 17.7 Der Kostenanschlag 359–360
- 360–361 17.8 Kündigungsrecht des Bestellers 360–361
- 361–368 Kapitel 18: Der Dienstvertrag 361–368
- 361–362 18.1 Grundlagen 361–362
- 362–362 18.2 Abschluss des Dienstvertrags 362–362
- 362–363 18.3 Vertragspflichten 362–363
- 363–364 18.4 Ansprüche wegen mangelhafter Dienstleistungen 363–364
- 364–368 18.5 Beendigung 364–368
- 368–396 Kapitel 19: Der Mietvertrag 368–396
- 368–369 19.1 Grundlagen 368–369
- 369–370 19.2 Abgrenzung zu anderen Verträgen 369–370
- 370–373 19.3 Abschluss des Mietvertrags 370–373
- 373–379 19.4 Pflichten der Parteien 373–379
- 379–381 19.5 Haftung für Mängel 379–381
- 381–389 19.6 Beendigung des Mietverhältnisses 381–389
- 389–390 19.7 Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit 389–390
- 390–395 19.8 Nachmieter, Untervermietung 390–395
- 395–396 19.9 Rechtslage nach Beendigung des Mietverhältnisses 395–396
- 396–402 Kapitel 20: Weitere Vertragstypen 396–402
- 396–397 20.1 Der Darlehensvertrag 396–397
- 397–399 20.2 Der Leasingvertrag 397–399
- 399–400 20.3 Der Factoringvertrag 399–400
- 400–400 20.4 Der Franchisevertrag 400–400
- 400–402 20.5 Der Lizenzvertrag 400–402
- 402–456 4. Teil: Gesetzliche Schuldverhältnisse 402–456
- 402–406 Kapitel 21: Überblick zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen 402–406
- 406–439 Kapitel 22: Recht der unerlaubten Handlungen 406–439
- 406–407 22.1 Grundlagen 406–407
- 407–424 22.2 Haftung aus §823 Abs. 1 BGB 407–424
- 424–426 22.3 §823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einem Schutzgesetz 424–426
- 426–428 22.4 Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§826 BGB) 426–428
- 428–439 22.5 Haftung für den Verrichtungsgehilfen (§831 BGB) 428–439
- 439–449 Kapitel 23: Allgemeines Schadensrecht 439–449
- 439–440 23.1 Grundlagen 439–440
- 440–441 23.2 Sondervorschriften (§§842 ff. BGB) 440–441
- 441–449 23.3 Allgemeine Regelungen (§§249 ff. BGB) 441–449
- 449–456 Kapitel 24: Ungerechtfertigte Bereicherung 449–456
- 449–450 24.1 Grundlagen 449–450
- 450–455 24.2 Voraussetzungen 450–455
- 455–456 24.3 Verfügung eines Nichtberechtigten 455–456
- 456–516 5. Teil: Sachenrecht 456–516
- 456–471 Kapitel 25: Grundlagen des Sachenrechts 456–471
- 456–458 25.1 Einführung 456–458
- 458–458 25.2 Eigentum 458–458
- 458–462 25.3 Besitz 458–462
- 462–463 25.4 Weitere Begriffe aus dem Sachenrecht 462–463
- 463–466 25.5 Das Trennungsprinzip (Abstraktionsprinzip) 463–466
- 466–471 25.6 Anspruchsgrundlagen im Sachenrecht 466–471
- 471–493 Kapitel 26: Der rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 471–493
- 471–472 26.1 Grundlagen 471–472
- 472–480 26.2 Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 472–480
- 480–493 26.3 Der gutgläubige Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 480–493
- 493–506 Kapitel 27: Der gesetzliche Eigentumserwerb 493–506
- 493–498 27.1 Grundlagen 493–498
- 498–500 27.2 Verbindung mit einem Grundstück: §946 BGB 498–500
- 500–501 27.3 Verbindung beweglicher Sachen: §947 BGB 500–501
- 501–505 27.4 Verarbeitung: §950 BGB 501–505
- 505–506 27.5 Rechtsfolge des §951 BGB 505–506
- 506–516 Kapitel 28: Recht der unbeweglichen Sachen 506–516
- 506–507 28.1 Grundlagen 506–507
- 507–509 28.2 Auflassung 507–509
- 509–510 28.3 Auflassungsvormerkung 509–510
- 510–510 28.4 Gutgläubiger Erwerb 510–510
- 510–511 28.5 Das Grundbuch 510–511
- 511–513 28.6 Erbbaurecht 511–513
- 513–516 28.7 Wohnungseigentumsrecht 513–516
- 516–556 6. Teil: Kreditsicherungsrecht 516–556
- Kapitel 29: Kreditsicherungsrecht
- 516–518 29.1 Grundlagen 516–518
- 518–530 29.2 Die Bürgschaft 518–530
- 530–533 29.3 Schuldbeitritt (kumulative Schuld(mit)übernahme) 530–533
- 533–534 29.4 Patronatserklärung 533–534
- 534–539 29.5 Garantievertrag 534–539
- 539–545 29.6 Der Eigentumsvorbehalt 539–545
- 545–549 29.7 Die Sicherungsübereignung 545–549
- 549–556 29.8 Pfandrechte 549–556
- 556–637 7. Teil: Grundlagen der Fallbearbeitung 556–637
- 556–583 Kapitel 30: Anleitung zur Lösung von Rechtsfällen 556–583
- 556–559 30.1 Schritte zur Fallbearbeitung 556–559
- 559–565 30.2 Bestimmung der Anspruchsgrundlage 559–565
- 565–571 30.3 Wichtige Anspruchsgrundlagen 565–571
- 571–578 30.4 Der Anspruchsaufbau 571–578
- 578–579 30.5 Prüfungsreihenfolge 578–579
- 579–583 30.6 Andere Aufgabenstellungen 579–583
- 583–637 Kapitel 31: Beispiele von Fallbearbeitungen 583–637
- 583–589 Fall 1: Damenmäntel 583–589
- 589–593 Fall 2: Vertrag oder nicht Vertrag, nur das ist hier die Frage 589–593
- 593–602 Fall 3: Computerbildschirme 593–602
- 602–606 Fall 4: Der rote Golf 602–606
- 606–609 Fall 5: Gammelfleisch 606–609
- 609–616 Fall 6: Außer Spesen noch was gewesen 609–616
- 616–620 Fall 7: Fahrt zur Schwarzwaldklinik 616–620
- 620–627 Fall 8: Der enttäuschte Camper 620–627
- 627–632 Fall 9: Der unwesentliche Motor 627–632
- 632–637 Fall 10: Dachpfannen 632–637
- 637–686 8. Teil: Glossar 637–686
- Glossar
- 686–687 Literaturverzeichnis 686–687
- 687–706 Sachregister 687–706
- 706–706 Impressum 706–706