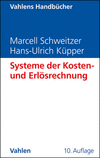Zusammenfassung
Dieses Standardwerk liefert Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aufgaben, Techniken und Systeme der Kosten- und Erlösrechnung. Zunächst führt es in die Grundlagen ermittlungsorientierter Systeme ein. Dazu gehören die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung, ein Spektrum, das in jeder Vorlesung zur Kostenrechnung gelehrt wird. Daran schließt sich die Darstellung planungs- und verhaltenssteuerungsorientierter Systeme an. Dabei handelt es sich um Methoden wie Prozesskosten-, Grenzplankosten- oder Deckungsbeitragsrechnungen und Target Costing, die im Alltag von höchster praktischer Relevanz sind. Abgeschlossen wird das Buch durch die Behandlung aktueller Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Kostenrechnung. Hierbei spielen insbesondere die Herausforderungen der Preisregulierung bei den Strom-, Gas- und Telekommunikationsmärkten eine große Rolle.
Die Autoren
Prof. Dr. Marcell Schweitzer lehrte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Tübingen.
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ulrich Küpper ist Inhaber des Lehrstuhls für Produktionswirtschaft und Controlling an der LMU in München.