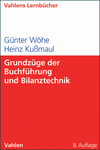Zusammenfassung
Der Klassiker zur Buchführung und Bilanztechnik.
Der Wöhe/Kußmaul zur Buchführung und Bilanztechnik
führt fundiert in das System der doppelten Buchführung und in die Technik der Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) ein.
Schwerpunkte sind die verrechnungstechnischen Grundlagen, die buchtechnische Behandlung der wichtigsten Geschäftsvorfälle bei Handels- und Industriebetrieben sowie die Technik der Aufstellung des Jahresabschlusses. Zusätzlich bietet das Werk einen fundierten Überblick über die gesetzlichen Vorschriften zur Führung von Büchern und zur Aufstellung des Jahresabschlusses sowie über die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.
Die 8. Auflage
berücksichtigt die Änderungen durch die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte sowie die Modifikationen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Leser finden zudem unter www.kussmaul.woehe-portal.de einen auf das Buch abgestimmten Multiple-Choice-Test.
- 25–44 1 Buchführung, Bilanz und Erfolgsrechnung als Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens 25–44
- 44–58 2 Gesetzliche Vorschriften zur Führung von Büchern und zur Aufstellung des Jahresabschlusses 44–58
- 96–101 4.2 Der Buchungssatz 96–101
- 236–241 5.7 Übungsaufgabe 3 236–241
- 292–302 6.5 Übungsaufgabe 4 292–302
- 332–343 6.9 Übungsaufgabe 5 332–343
- 368–380 7.4 Übungsaufgabe 6 368–380
- 380–383 Literaturverzeichnis 380–383
- 383–397 Stichwortverzeichnis 383–397